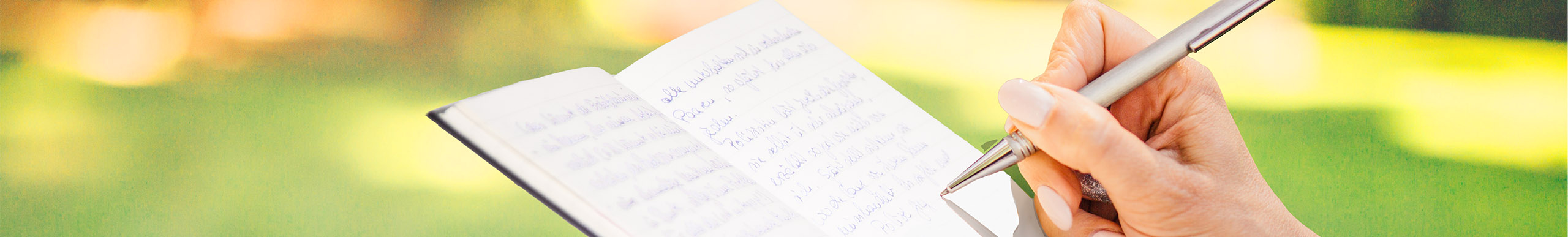Gerade las ich einen hochspannenden Roman – Rezension folgt in Kürze – geschrieben aus der Perspektive eines Ich-Erzählers. Dadurch ist die Leserin sehr nah an, ja quasi in dem Protagonisten, sieht was er sieht, fühlt was er fühlt. Der Autor erreicht damit meiner Meinung nach die höchstmögliche Empathie bei seinen Leser*innen. Allein diese Form der Erzählweise hat ein großes Manko: Die Handlung kann nur aus der Sicht einer Person erzählt werden, d.h. nur das, was der Ich-Erzähler selbst erlebt oder ggf. berichtet bekommt, kann in dem Roman geschildert werden. Und genau das war das Problem in dem oben erwähnten Buch, das ich gerade verschlungen habe: es gab drei Protagonisten, die logischerweise nicht ständig zusammen waren und somit erlebte jede*r eigene „Abenteuer“. Diese wurden detailliert und wie gesagt hochspannend erzählt, ohne dass der Ich-Erzähler dabei gewesen wäre. Die Leserin muss sich also quasi dazu denken, dass die beiden anderen Protagonisten dem „Ich“ von ihren Erlebnissen berichtet hatten und er sie nun also nacherzählt.
Dabei hat der Autor das so geschickt gelöst, dass es gar nicht störte. Dazu nutzte er einen besonderen Kniff: nur beim Ich-Erzähler war er tatsächlich im Kopf seines Charakters, man konnte seinen Gedanken folgen, seinen Qualen, wenn er eine Entscheidung zu treffen hatte, seine Gefühle nachempfinden, wenn er ängstlich, glücklich oder aufgeregt war. Die Szenen der beiden anderen Protagonisten wurden in auktorialer Erzählform geschrieben, wir haben also „nur“ miterlebt, was sie erlebten, nahmen aber an ihren Gedanken und Gefühlen nicht teil. So kann die Leserin sich unbewusst wirklich vorstellen, dass der Ich-Erzähler sozusagen die Geschehnisse vom Hörensagen kennt und nacherzählt.
Vorsicht Falle!
Die Ich-Perspektive scheint auf den ersten Blick eine einfache zu sein, die es Autor*innen leichter macht, sich in ihren Protagonisten hineinzuversetzen. Dabei läuft zwar manch ein Autor in die Falle, dass er sich zu sehr selbst mit seiner Hauptfigur identifiziert. Abstand von seiner Figur zu halten ist mit der personalen und natürlich der auktorialen Perspektive leichter. Aber viel gefährlicher ist beim Ich-Erzähler, dass es so furchtbar leicht passieren kann, dass diese Figur von Dingen berichtet, die sie nicht wissen kann. Und schon ist die Autorin in die Falle getappt. Denn selbst wenn sie immer daran denkt und gut aufpasst, kann es auch schwierig werden, diese Klippe zu umschiffen. Ständig zu schreiben: „Der So-und-So hat mir erzählt, dass …“ oder „ich hörte später, dass Das-und-Das passiert war“. Das macht den Text, so meine ich jedenfalls, recht sperrig.
Stolpersteine
Also doch die personale Erzählform wählen? Die sich, wie du bestimmt weißt, von der auktorialen dadurch unterscheidet, dass du zwar in der dritten Person schreibst, aber dennoch nur im Kopf einer Person, meist sicher des Protas, bist. Das heißt, auch hier kannst du nichts erzählen, bei dem der Prota nicht dabei war, hast aber dennoch eine graduell größere Distanz zu deiner Figur. Jedenfalls empfinde ich es so. Dieses Perspektivproblem lösen übrigens viele Autor*innen, besonders in den letzten Jahren, dadurch, dass sie verschiedenen Figuren erzählen lassen, ihren Roman eben einfach aus mehreren Perspektiven erzählen.
Aber auch bei der personalen Perspektive gibt es Fallstricke. Über die viele stolpern und die einer Autorin in ihren eigenen Texten oft gar nicht auffallen – was mal wieder die Bedeutung von Testlesern unterstreicht. Es passiert nämlich ziemlich oft, Anfängern wie Profis, dass sie unbemerkt eben doch plötzlich im Kopf einer anderen als der Hauptfigur stecken und, schlimmstenfalls mitten in einer Szene, wissen, was diese denkt und wie sie die Geschehnisse sieht.
Die richtige Wahl treffen
Mir persönlich gefällt dennoch diese Art der Erzählperspektive besser als die auktoriale. Gerade weil die Leserinnen dann so viel näher an meiner Prota sein können, es mir als Autorin vermutlich auch leichter gelingt, dass sie mit ihr mitfühlen, dass sie mit ihr leiden und sich mit ihr freuen. Und wenn eine Leserin derart dicht an der Hauptfigur ist, wird der Roman oder die Kurzgeschichte automatisch für sie spannend, denn wer mitfühlt will doch auch wissen, wie es der Heldin am Ende ergeht. Eben.
Und weil wir ja schließlich keine Herausforderungen scheuen, haben wir natürlich auch keine Angst vor den Fallen, die je nach Wahl der Perspektive auf uns lauern. Wichtig ist, so finde ich, dass wir, wenn wir Fehler machen, daraus lernen (sorry, schon wieder einmal eine Binsenweisheit, ich weiß, aber sie sind nun mal leider so oft auch wahr).
Mir selbst ist es gerade so ergangen – woraus dann dieser Blogbeitrag entstand. Ich habe eine ältere Geschichte von mir neulich zwecks Veröffentlichung verschickt und den dortigen Testlesern fiel auf, was bislang noch niemand beanstandet hatte. Dass ich nämlich mitten in der Handlung von seinem Kopf in ihren Kopf hüpfe und dann wieder zurück. Tja, zum Glück für mein Selbstwertgefühl hielten die Testleser das für einen geschickten Kniff von mir, dennoch ist das natürlich – weil es mir aus Unachtsamkeit passierte und nicht bewusst eingesetzt wurde – ein grober Schnitzer, ganz besonders, weil es mir selbst bei all den vielen Malen, die ich diese Geschichte gelesen und überarbeitet hatte, nie selbst aufgefallen war. Klar, davon geht die Welt nicht unter, ich möchte damit ja auch nur zeigen, wie aufmerksam wir sein müssen und wie dankbar unseren Testlesern.
Probieren geht über Studieren
Die Perspektive, aus welcher wir unsere Geschichten erzählen, ist ein, wenn nicht das wichtigste Stilmittel. Daher sollten wir uns sehr sicher sein, welche diejenige ist, die am besten passt und am besten wirkt. Ich fürchte, dabei hilft nur Ausprobieren. Wir müssen uns vor dem Schreiben überlegen, welche wir wählen, und das heißt, wir sollten verschiedene Blickwinkel einnehmen und durchspielen. Dabei kann es dir vielleicht so wie mir einmal ergehen, als ich eine ziemlich lange Geschichte, nachdem sie fertig war, nochmal komplett umgeschrieben habe, von der dritten Person zu einer Ich-Erzählerin wechselte und damit eine völlig andere, viel größere Wirkung erreichte.
Das Fazit ist also, dass wir zuerst die geeignetste Perspektive entdecken müssen und dann müssen wir auch noch aufpassen wie ein Luchs, dass wir nicht ungewollt in eine anderen wechseln, da wo es nicht hingehört. Stell dir also beim Schreiben oder spätestens beim Überarbeiten immer wieder die Frage: „In wessen Kopf bin ich grade?“ (Außer natürlich du schreibst aus der auktorialen Perspektive, bei der du in niemandes Kopf bist.)
Apropos Ausprobieren: Außer der passendsten Perspektive musst du vor dem Schreiben auch noch entscheiden, in welcher Zeitform du schreiben willst, Präsens oder Präteritum. Auch so etwas, weswegen ich schon mal einen Text wieder komplett neu schrieb. Darüber aber in einem anderen Blog mehr.